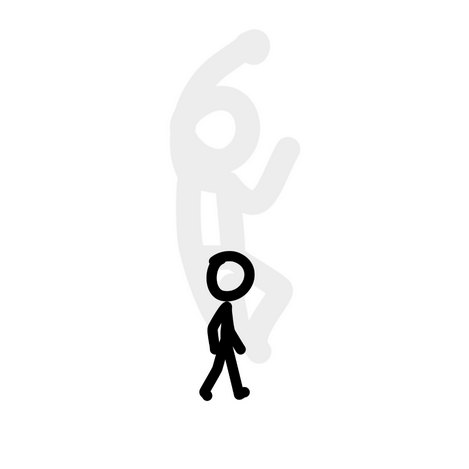Manche Fragen tauchen immer wieder auf, wenn Menschen beginnen, sich mit RUmeK bzw. KoRUk zu beschäftigen: Wir haben diese Fragen gesammelt und versuchen, sie hier kurz zu beantworten.
Wenn Sie eine weitere Frage einbringen möchten, schreiben Sie uns: koko.community@elkb.de
Was ist die kokoRU-Community?
Mit der kokoRU-Community steht Ihnen eine Plattform zur Verfügung, die Ihnen hilft, sich mit anderen Religionsunterrichtenden zu vernetzen. Sie können hier Ihre Fragestellungen zur konkreten Umsetzung eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts einbringen und diskutieren. Mit der Zeit entsteht hier ein Netzwerk von kompetenten Personen und bewährten Praxiserfahrungen.
Wer steht als Ansprechpartner zur Verfügung?
Ihre ersten Ansprechpartner/-innen sind die (evangelischen) Schulreferent/-innen und die (katholischen) Fachmitarbeiter/-innen, die Sie auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Bei ihnen bekommen Sie verbindliche Antworten auf ihre Fragen.
Sabine Keppner (sabine.keppner@rpz-heilsbronn.de), Referentin der Grundschule am RPZ Heilsbronn, steht Ihnen für alle Fragen rund um konfessionell-kooperative Didaktik, besonders für den Bereich der Grundschule, gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zur kokoRU-Community können Sie sich an koko.community@elkb.de wenden.
Dort antworten:
Barbara Zitzelsberger (barbara.zitzelsberger@elkb.de), Beauftrage für die RUmeK-Community der Evangelischen Landeskirche in Bayern
Heike Kellner-Rauch, (hkellner-rauch@irl-bayern.de), Wissenschaftliche Referentin für Mittelschule am IRL in Bayern
Franziska Pichler (fpichler@irl-bayern.de), Wissenschaftliche Referentin für Grundschule am IRL Bayern
Was ist konfessionell-kooperativer Religionsunterricht?
Der Religionsunterricht an bayerischen Schulen ist gem. Art. 136 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft erteilt. Sowohl RUmeK als auch KoRUk sind konfessioneller Religionsunterricht und bezeichnen jeweils eine besondere Organisationsform des konfessionellen RU. Die Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung liegt bei der unterrichtenden Lehrkraft im Auftrag der evangelischen bzw. katholischen Kirche. Es gilt der jeweilige Lehrplan.
Die Möglichkeit, Religionsunterricht konfessionell-kooperativ zu organisieren unterstützt die Schulen darin, Religionsunterricht flächendeckend so anbieten zu können, dass sehr große Unterrichtsgruppen, ungünstige Gruppenzusammensetzungen oder das Verschieben in Randstunden am Nachmittag vermieden werden können. Für kirchliche Religionslehrer/-innen besteht zudem der Vorteil, die Zersplitterung der Deputate auf zu viele Schulhäuser eindämmen zu können.
Die konfessionell-kooperative Organisation steht damit im Dienst eines attraktiven und profilierten Religionsunterrichts.
„Konfessionssensibilität“ ist das didaktische Herzstück des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts: eine klare Verortung des Religionsunterrichts in einer konkreten Konfession kommt durch die Umsetzung des jeweiligen Lehrplans zum Tragen. Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Perspektiven der anderen Konfession und v.a. die Welterfahrung der Schüler/-innen bewusst eingebracht werden. Das Wahrnehmen der Verschiedenheit und das Verstehen des Gemeinsamen stehen dabei im Mittelpunkt. Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht verwischt also keine Unterschiede, vielmehr ist er ein wertvoller Beitrag zur Stärkung des konfessionellen Profils des Religionsunterrichts.
Seit wann gibt es konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Bayern?
Konfessionell-kooperativer RU in Bayern hat eine längere Geschichte der Annäherung und innerkirchlichen Diskussion sowohl in den bayerischen (Erz-) Diözesen als auch in der ELKB.
RUmeK (Religionsunterricht mit erweiterter Kooperation) an Grund- und Mittelschulen ist seit dem Schuljahr 2019/2020 eingeführt und ist seit dem Schuljahr 2025/26 verstetigt.
Seit 2024 ergänzt KoRUk (Konfessioneller Religionsunterricht kooperativ) das Organisationsmodell RUmeK: KoRUk ist seit dem SJ 24/25 Modellprojekt für die Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschulen, befristet bis einschl. Schuljahr 25/26.
Für die Beruflichen Schulen läuft mit dem Projekt StReBe (Stärkung des Religionsunterrichts an beruflichen Schulen) ein verwandter Prozess.
Die jeweiligen Projekte werden wissenschaftlich begleitet und stetig weiterentwickelt. 2023 fand eine intensive Evaluation von RUmeK statt. Ergebnisse der Evaluation von StReBe sind bereits veröffentlicht worden. Sie finden den Link in unserer Bibliothek.
Unter welchen Bedingungen kann RUmeK eingeführt werden?
Konfessioneller RU ist für bekenntnisangehörige Schüler/-innen Pflichtfach. Der klassische, konfessionelle RU ist die Regelform. Jahrgangsübergreifende Gruppen können weiterhin eingerichtet werden.
Wenn entsprechende Voraussetzungen vorliegen, kann eine Schule eine andere Organisationsform, RUmeK oder KoRUk, beantragen. Beide Modelle beziehen sich ausschließlich auf Grund- und Mittelschulen.
Voraussetzungen
RUmeK (Jahrgangsstufen 1 – 4 sowie Mittelschule) kann eingerichtet werden, wenn „keine pädagogisch sinnvolle konfessionelle Lerngruppe eingerichtet werden kann“ (KMS Az. III.3-BS7401.3/11/1 vom 11.4.2023). Die Mindestanzahl für die Einrichtung einer konfessionellen Lerngruppe sind fünf getaufte oder auf Antrag teilnehmende Schüler/-innen Es gilt: Die Mehrheitskonfession stellt Lehrplan und Lehrkraft, die Minderheitskonfession eine Expertin oder einen Experten.
KoRUk (Jahrgangsstufe 1 und 2): Wenn keine klare Mehrheits-/Minderheitssituation von katholischen und evangelischen Schüler/-innen gegeben ist, können für die Jahrgangsstufe 1 und 2 Religionsgruppen gebildet werden, die sich aus evangelischen, katholischen und Schüler:innen zusammensetzen, die auf Antrag am RU teilnehmen. Die Lehrkraft kann katholisch oder evangelisch sein. Die Konfession der Lehrkraft bestimmt den geltenden Lehrplan und den Noteneintrag.
Konfessionssensibilität ist leitendes Prinzip, das Hinzuziehen von Expert/-innen wird empfohlen.
Auch wenn RUmeK eingerichtet werden könnte, aber die Lehrkraft der Mehrheitskonfession fehlt, ist KoRUk eine mögliche Organisationsform.
Mehrheitskonfession – Minderheitskonfession?
Die Begriffe "Mehrheitskonfession" und "Minderheitskonfession" sind ausschließlich beschreibende Begriffe für die konkrete konfessionelle Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler. Gibt es mehr katholische Schüler/-innen als evangelische Schüler/-innen in einer zu bildenden Lerngruppe, befindet sich die römisch-katholische Kirche in der Mehrheitsposition - und umgekehrt. Daraus folgen die Verantwortlichkeiten für die Genehmigungsverfahren und die Bereitstellung der Lehrkräfte. Es sind mit diesen Begriffen keinerlei Abwertung und auch kein Othering verbunden: Sie sind Verwaltungsprinzipien für die Klassenbildung.
Welcher Unterschied besteht zwischen RUmeK und KoRUk?
Der wesentliche Unterschied zwischen RUmeK und KoRUk liegt darin, dass die Mehrheitsverhältnisse der konfessionellen Zugehörigkeit der Schüler/-innen als Kriterium für die Wahl der Organisationsform in den Hintergrund treten. In beiden Formen, in RUmeK und KoRUk, unterrichten die Lehrkräfte konfessionssensibel.
Im KoRUk wird, ähnlich wie im RUmeK, das Hinzuziehen eines Experten, einer Expertin der anderen Konfessionen empfohlen. Für KoRUk ist das aber nicht verpflichtend.
Welche Rolle haben die „Experten“ für RUmeK und KoRUk inne?
Konfessionssensibilität ist zuallererst eine Haltung: „Die Anderen“ sind nicht die Fremden, sie sind die Geschwister im Glauben. Wir sind gemeinsam auf dem Weg um das Reich Gottes Wirklichkeit werden zu lassen, von der heilsamen Zuwendung Jesu zu den Menschen zu künden und Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die uns trägt.
Dennoch entstehen in konfessionssensiblen Unterrichtszusammenhang nicht selten Unsicherheit über die verschiedenen Traditionen, theologische Differenzen und den konkreten Umgang mit „speziellen Themen“ der anderen Konfession.
Da ist es gut, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben - eben einen Experten.
Die „Experten“ sind ein Ausdruck des Aspekts „Kooperation“ im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht: Die „Experten einer Konfession“ stehen den unterrichtenden Lehrkräften der „anderen Konfession“ für Fragen bezüglich ihrer Konfession zur Verfügung.
Zugleich wird die Zusammengehörigkeit und die Geschwisterlichkeit beider Konfessionen in der Organisationsform RUmeK durch das Einbeziehen eines Experten der Minderheitskonfession deutlich und für die Schüler/innen erlebbar.
Deutlich wird das zum Beispiel, wenn der Experte gemeinsam mit der unterrichtenden Lehrkraft im Teamteaching einzelne Unterrichtseinheiten gestaltet: Als Gast im regulär stattfindenden RU oder an Projekttagen. Projekttage können beispielsweise zu gemeinsamen christlichen Festen, zur Jahreslosung, zu typischen Themen einer Konfession gestaltet werden. Auch ist es möglich in diesen Expertenstunden eine Kirchenbesichtigung zu unternehmen und so vor Ort, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der christlichen Gotteshäuser wahrzunehmen.
Jeder RUmeK-Gruppe ist ein Experte zugeordnet, der bis zu 12 Unterrichtseinheiten im Schuljahr begleiten kann.
Die Vergütung findet auf evang. Seite im Rahmen von sogenannten Springerstunden statt. Auf kath. Seite erfolgt die Vergütung durch Anrechnungsstunden bzw. die Ehrenamtspauschale.
Der Experte handelt nur in Absprache mit dem unterrichtenden Kollegen: Er ist nicht für Leistungsnachweise, Notengebung, Jahresplanung und Weiteres verantwortlich.
Bei KoRUk soll nach Möglichkeit eine Person als kirchliche Vertretung der Konfession, die nicht durch die Lehrkraft repräsentiert wird, im Unterricht beteiligt werden. Dies kann beispielsweise ein Mitglied des Pfarrverbands, ein Kirchenvorsteher, ein Priester, Pfarrer, Diakon oder ein kirchlicher Ehrenamtlicher vor Ort sein. Einen solchen Experten zu finden liegt in der Eigenverantwortung der unterrichtenden Lehrkraft.
Wie werde ich Experte?
Experten werden mit 12 Sunden pro RUmeK-Gruppe je Schuljahr an der Schule eingesetzt. Ein Einsatz als Experte kann also z.B. sehr attraktiv sein für Personen, die nach der Elternzeit wieder in ihren Beruf zurückkehren möchten. Auch Religionslehrer/-innen, die Freude an Projektarbeit haben können hier ein interessantes Arbeitsfeld finden. Ein gewisses Maß an Offenheit, Neugierde und Flexibilität ist sicherlich ebenso von Vorteil wie eine gute Kommunikationsfähigkeit und eine gefestigte Lehrerpersönlichkeit.
Wenn Sie selbst Experte werden möchten, wenden Sie sich an Ihren (katholischen) Fachmitarbeiter/-in oder ihren (evangelischen) Schulreferenten.
Wer muss was wann tun?
RUmeK und KoRUk werden jeweils im Mai von den Schulen im Einvernehmen mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt bei der zuständigen kirchlichen Stelle (RUmeK: Mehrheitskonfession; KoRUk: beide Konfessionen) beantragt. Eine Ablehnung ist möglich. Der Antragsstellung zustimmen müssen zudem die unterrichtende Lehrkraft, die Erziehungsberechtigten und das zuständige Staatliche Schulamt. Rückmeldung zur Genehmigung erfolgt in der Regel bis Ende Juni.
Die Antragsstellung auf RUmeK bzw. KoRUk obliegt allein der Schulleitung. Diese wird rechtzeitig über alle Belange wie Antragsformular, Fristen, Elternbrief usw. durch die zuständigen staatlichen Schulämter informiert. Die Schulleitung beantragt bei vorliegenden Voraussetzungen die Einrichtung konfessionell-kooperativer Unterrichtsmodelle zum folgenden Schuljahr. Dies geschieht mit dem entsprechenden Formular bei den für Ihr Gebiet zuständigen kirchlichen Ansprechpartnern.
Den Antrag auf RUmeK unterzeichnet die Schulleitung und die Lehrkraft der Mehrheitskonfession, bevor dieser beim (katholischen) Schulreferat bzw. (evangelischen) Schulbeauftragten vor Ort der Minderheitskonfession eingereicht wird.
Der Antrag auf KoRUk wird bei allen beteiligten Konfessionen eingereicht.
Wer entscheidet, ob konfessionell-kooperativer RU eingerichtet wird?
Der konfessionelle RU ist die Regelform der Organisation des RU. Die konfessionell-kooperativen Unterrichtsformen (RUmeK bzw. KoRUk) sind die Ausnahmen. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ob RUmeK oder KoRUk erteilt wird, liegt im alleinigen Ermessen der kirchlichen Aufsichtsbehörden (katholisches Schulreferat bzw. evangelische/r Schulbeauftragte/-r) in Übereinkommen mit dem zuständigen staatlichen Schulamt. Diese Entscheidung versucht, alle schulspezifischen, örtlichen und personellen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Aus personell-organisatorischen Gründen kann er u.U. auch abgelehnt werden. Der Antrag ist derzeit jährlich neu zu stellen.
Wird es ein konfessionell-kooperatives Schulbuch geben?
Für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Bayern werden zunächst einzelne Unterrichtsmaterialien in Verantwortung des RPZ Heilsbronn und des IRL in Bayern erstellt werden.
Die Websites der beiden Institute und natürlich die kokoRU-Community auf www.kilometer10.de informieren Sie regelmäßig darüber.
Nach welchem Lehrplan wird unterrichtet?
Für konfessionell-kooperativen Religionsunterricht gilt jeweils der Lehrplan der Konfession, der die unterrichtende Lehrkraft angehört. Der Blick auf die Kompetenzerwartung des Lehrplans der anderen Konfession kann sowohl von der betreffenden Jahrgangsstufe, dem Gegenstandsbereich oder aber dem Thema her erfolgen.
Wo es fachliche Unsicherheiten gibt – etwa bei Fragen wie dem Amts- oder Sakramentenverständnis, speziellen Feiertagen etc. - helfen nicht nur die zuständigen Expert/-innen sondern auch die Sprechstunden und das Forum der kokoRU-Community.
Wo finde ich Möglichkeiten zum Austausch?
Zuallererst: bei Ihren Kolleg/-innen vor Ort, an der Schule, im Schulamtsbezirk, im Dekanat. Die Kompetenzen und jeweilige Expertise zusammen zu bringen und Erfahrungen und Material zu teilen ist für jede Art der Schul- und Unterrichtsentwicklung der wesentliche erste Schritt: sharing is caring! Sie kennen dieses Prinzip aus Arbeitskreisen – und vielleicht wäre kokoRU ja ein geeigneter Anlass, um über gemeinsame ökumenische Treffen der religionspädagogischen Arbeitskreise nachzudenken.
Die kokoRU-Community bietet Ihnen die Möglichkeit zum Austausch auf weiter Fläche: von Unterfranken bis Niederbayern, von der Oberpfalz bis nach Schwaben sind die Situationen für den (konfessionell-kooperativen) Religionsunterricht so verschieden, dass ein voneinander Hören, umeinander Wissen und einander Kennen nicht nur höchst interessant und spannend, sondern auch wesentlich ist für die Weiterentwicklung des konfessionellen Religionsunterrichts.
Die Möglichkeit zum Austausch mit Kollegen finden Sie in den Foren hier auf der Homepage der Community.
Haben Sie konkrete Fragestellungen und Anliegen können Sie diese im Moment gerne per E-mail an die Ansprechpartner schreiben. Einmal im Monat findet online das "Kilometer 10 Lehrerzimmer" von 17:00-18:00 Uhr statt. Nach einem kurzem Impuls ist Zeit und Raum für Fragen, Anliegen. und Wünsche zu RUmeK und KoRUk, sowie die Möglichkeit für Austausch und Vernetzung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Termine sowie die Zugangsdaten finden Sie auf der Homepage Kilometer 10 - Lehrerzimmer.
Und natürlich: Das RPZ Heilsbronn und das IRL in Bayern bieten Fortbildungen zum Themenfeld der Konfessionssensibilität an - oft auch in Kooperation mit den begleitenden Hochschulen.
Wo finde ich Fortbildungen zu konfessionell-kooperativem Religionsunterricht?
Im Fortbildungssystem der bayerischen Schule, FibS finden Sie die Fortbildungsangebote für Lehrkräfte aller Konfessionen. Die katholischen (Erz-)Diözesen und das RPZ Heilsbronn freuen sich ebenso wie das IRL in Bayern über Ihre Anmeldung: auch wenn Sie einer anderen Konfession angehören als das veranstaltende Institut.
Wo finde ich passendes Material für konfessionell-kooperativen Religionsunterricht?
Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht ist konfessioneller Religionsunterricht einer Konfession und berücksichtigt die Kompetenzerwartungen der Partner-Konfession für die konkrete Lerngruppe. Die Aufgabe einer passgenauen Unterrichtsvorbereitung zu planen, liegt verantwortungsvoll in der Hand der unterrichtenden Lehrkraft.
Material zu konfessionell-kooperativem RU finden Sie für die Grundschule auf den Seiten des RPZ Heilsbronn und besonders auf der Task Card, die von Sabine Keppner erarbeitet worden ist.
Für die Mittelschule finden Sie beim RPZ Heilsbronn unter dem Stichwort 'Unterrichtspraxis' konkrete Beispiele, die Sie sicherlich auch im konfessionell-kooperativen RU sinnvoll einsetzen können.
Für die (Weiter-)Entwicklung Ihrer bewährten Unterrichtsmaterialien sind die religionspädagogischen Arbeitskreise vor Ort und die kokoRU-Community hervorragende Orte: Tauschen Sie sich (und Ihr Material) aus, stellen Sie anderen zur Verfügung, was sich bewährt hat und profitieren Sie von den Ideen und Erfahrungen der Kolleg/-innen. Nutzen Sie dafür gerne die kokoRU-Community und Ihre Ansprechpartnerinnen, Barbara Zitzelsberger, Franziska Pichler und Heike Kellner-Rauch.
Und natürlich bietet das online "Kilometer 10 Lehrerzimmer" einmal im Monat von 17:00-18:00 Uhr die Möglichkeit für Austausch und Vernetzung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Termine sowie die Zugangsdaten finden Sie auf der Homepage Kilometer 10 - Lehrerzimmer.
Wer ist für die Jahresplanung, Leistungsnachweise und Notengebung verantwortlich?
Bei der Erstellung der Jahresplanung gehen Sie wie gewohnt vor und verwenden den Lehrplan Ihrer Konfession. Berücksichtigen Sie die spezifischen Inhalte und Kompetenzerwartungen der Minderheitskonfession proaktiv.
Beziehen Sie für RUmeK den Ihnen zugeordneten Experten bitte frühzeitig in Ihre Jahresplanung ein: Besprechen Sie mögliche Themengebiete und konkrete Termine. Überlegen Sie sich hierbei, ob Sie die Teamteaching-Stunden mit dem Experten schwerpunktmäßig dafür verwenden möchten, um die Gemeinsamkeiten der christlichen Konfessionen zu stärken oder ob Sie in diesen Stunden, die konfessionellen Unterschiede thematisieren.
Prinzipiell kann eine Kooperation zu allen Themen des Lehrplans erfolgen. In welchen Bereichen dies sinnvoll ist, hängt stark von Ihrem Ziel ab. Umso klarer Sie mit dem Experten absprechen, was Ihre Bedarfe und Pläne sind, umso fruchtbarer wird die Kooperation für das Lernen der Schüler/-innen sein.
Die Erstellung und Durchführung von Leistungsnachweisen und die Notengebung liegen in den Händen der dauerhaft unterrichtenden Lehrkraft. Selbstverständlich können Inhalte im Leistungsnachweis abgefragt werden, die in Unterrichtsstunden mit dem Experten gemeinsam erarbeitet worden sind.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Gesamtverantwortung für RUmeK bzw. KoRUk trägt die unterrichtende Lehrkraft.
Wie gehe ich im Zeugnis mit konfessionell-kooperativem Religionsunterricht um?
Die Note sowie die Zeugnisbemerkung verantwortet die unterrichtende Lehrkraft.
Im Organisationsmodell RUmeK erhalten die Schüler/innen eine Zeugnisnote im Fach Religionslehre der Mehrheitskonfession. Die Zeugnisbemerkung „Die Schülerin/der Schüler hat am ‚Konfessionellen Religionsunterricht mit erweiterter Kooperation‘ (RUmeK) teilgenommen.“ verweist auf die Organisationsform. Dieser ist für die Schüler/-innen der Minderheitskonfession verpflichtend. Ob auch die Schüler/-innen der Mehrheitskonfession die Zeugnisbemerkung erhalten sollen, ist nicht dezidiert geregelt.
Wurde im Organisationsmodell KoRUk unterrichtet, erhalten die Schüler eine Zeugnisnote im Fach Religionslehre in der Konfession, der die unterrichtende Lehrkraft angehört und deren Lehrplan zugrunde lag. Die Zeugnisbemerkung „Die Schülerin/der Schüler hat am ‚konfessionellen Religionsunterricht kooperativ‘ (KoRUk) teilgenommen.“ verweist auf die Organisationsform des erteilten Religionsunterrichts. Dieser ist für die Schüler/-innen der Minderheitskonfession vorgegeben. Ob auch die Schüler/-innen der Mehrheitskonfession diese Zeugnisbemerkung erhalten sollen, ist nicht geregelt
Kann in RUmeK der „Quali“ geschrieben werden?
Die Verantwortung für die Notengebung und die Erstellung und Korrektur der Prüfungsaufgaben trägt die unterrichtende Lehrkraft auf Basis der Sequenz- und Jahresplanung.
Dies gilt auch für die Besondere Leistungsfeststellung an der Mittelschule, dem Qualifizierenden Abschluss („Quali“).